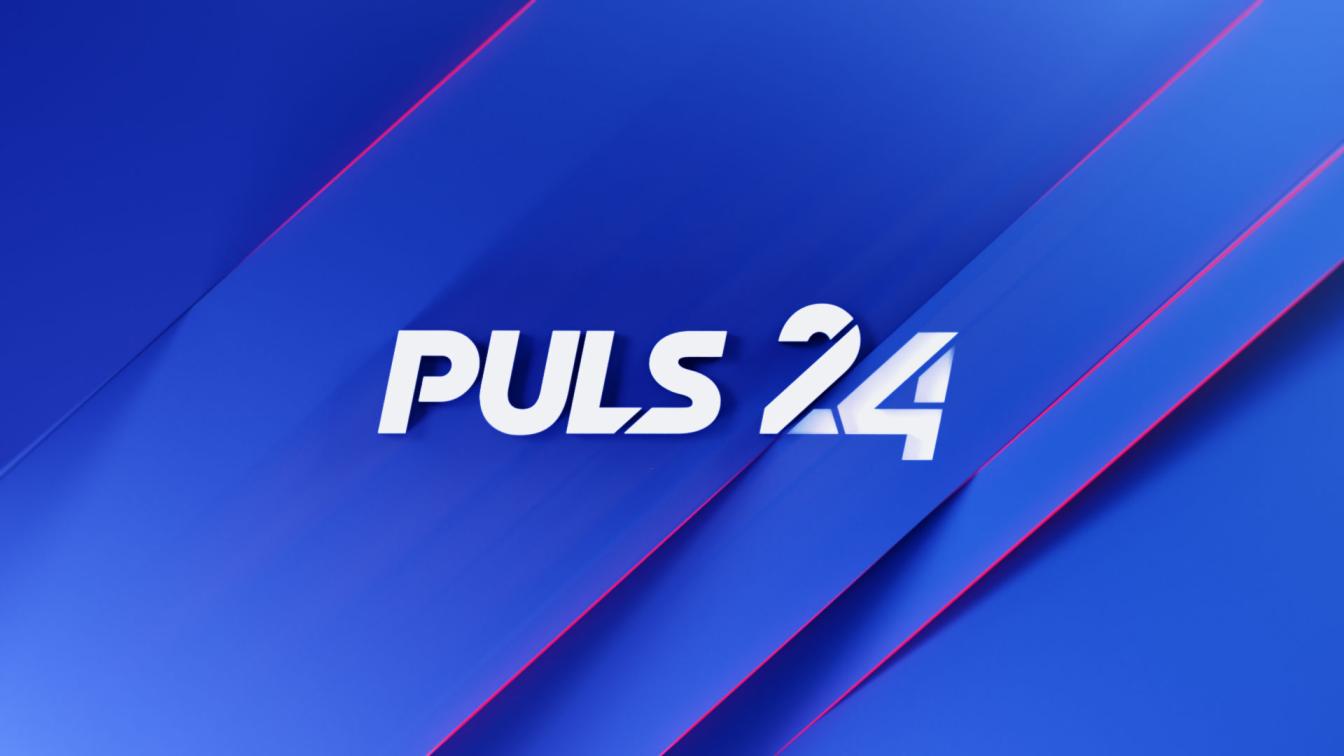Flut und Dürre zugleich - der Klimawandel in Sambia
Schwer getroffen wurde etwa das Ehepaar Mike Siasaniyama und Charity Chilenga: Wo sie früher über fruchtbares Ackerland verfügten, stehen sie nun auf einer riesigen Sandkiste. Seit Anfang Februar ist das so: In unmittelbarer Nähe des Gehöfts der Familie im Distrikt Kalomo in Sambias Südprovinz brach wegen der schweren Regenfälle ein massiver Damm, die Felder wurden überflutet.
In Kalomo, einem Distrikt in der Südprovinz Sambias, rund 400 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Lusaka, kam die Flut am 2. Februar. Doch, wie Siasaniyama und Chilenga schildern, hat das Wasser dem Boden nichts gebracht. Es ist trocken wie zuvor. "Das Wasser stieg sehr schnell und war auch sehr schnell wieder weg", erzählt der 55-Jährige. "Es begann mit einem seltsamen Geräusch. Wir fanden am nächsten Tag heraus, was das war, nämlich der Dammbruch", sagt Chilenga. Was die Flut hinterlassen hat, ist der Sand. Etwa einen Meter hoch oder mehr hat er das Feld der Familie bedeckt. Ihn wegzubringen dauert ohne Bagger zumindest eine halbe Ewigkeit. Und Bagger sind in der sambischen Peripherie Mangelware, hier in Siachitema, fernab jeder befestigten Straße, sowieso.
Die erste Nothilfe erreichte die Familie, die in einer Hütte die Flut überdauerte, nach vier Tagen. Mitarbeiter des Distriktsbüros Kalomo der internationalen Hilfsorganisation CARE brachten Lebensmittel und andere Güter. Auch finanzielle Hilfe folgte. 800 Kwacha in zwei Tranchen dürfen Siasaniyama und Chilenga erwarten - etwas über 40 Euro, für sambische Verhältnisse viel Geld, mit dem sich die Familie eine Zeit lang selbst helfen kann. "Von Regierungsvertretern kam bisher überhaupt nichts", betont Siasaniyama. Offen bleibt auch, wer den Damm wann repariert.
Die wirklich harte Zeit kommt noch. Die Trockenzeit hat gerade erst begonnen. Anbauen kann die Familie frühestens zum Beginn der nächsten Regenzeit im europäischen Spätherbst bzw. sambischen Frühling. Vorausgesetzt, die Felder sind dann wieder benutzbar. "Eine neue Saat funktioniert nicht", so Chilenga. Mit der zerstörten Ernte heuer und der langen Wartezeit, bis die nächste Ernte - hoffentlich - eingefahren werden kann, wird es zu einer großen Herausforderung, sich selbst und die Tiere, welche die Familie hält, über die Runden zu bringen. Am Hof leben zwölf Ziegen, sechs Rinder und einige Hühner.
Das im Grunde politisch stabile Sambia kämpft seit Jahren mit einer chronischen Krise, und das unter völligem Desinteresse der Weltöffentlichkeit. Die Rate der unterernährten Kinder in dem südostafrikanischen Land ist außerordentlich hoch: Landesweit haben vier Prozent aller Kinder für ihre Größe zu wenig Gewicht, mit durchaus starken regionalen Schwankungen. Akute Unterernährung ist bei Kindern ein großes Thema, und das vor allem in ländlichen Gebieten. Dazu kommt die gerade für sambische Kinder teils tödliche Krankheit Durchfall. All das wiederum hängt mit oft mangelnden Hygienebedingungen und Zugängen zu sauberem Trinkwasser zusammen.
Seit 2020 findet sich das Land jedes Jahr im CARE-Report über die vergessenen Krisen - jene Katastrophen, von denen jeweils mehr als eine Million Menschen betroffen sind und über die am wenigsten in Online-Medien im Laufe eines Jahres berichtet worden ist. Im Report 2023 lag Sambia auf Platz vier, im Jahr davor war es jenes Krisen-Land, über das überhaupt am wenigsten berichtet wurde. Und die Krise in Sambia ist ein Paradebeispiel für die Folgen des Klimawandels.
Die vergangene Regenzeit brachte Niederschläge in besonders großen Mengen, die auf den von langer Dürre ausgedörrten Boden fielen. Resultat: Der Grund konnte das Wasser nicht aufnehmen, es stieg rasch, überflutete große Landstriche, unterspülte Dämme. Mehrere brachen, weitere Gebiete wurden überflutet. Das Hochwasser verschwand mehr oder weniger schnell. Aber es floss ab, versickerte nicht im Boden. Zurück blieben nur, wie bei Siasaniyama und Chilenga, Tonnen von Sedimenten, die die Fluten mit sich transportiert hatten und welche die Felder weiter verwüsteten. Von 116 sambischen Bezirken waren ein Fünftel bis ein Sechstel betroffen.
Im Distrikt Monze, knapp 200 Kilometer von Lusaka in südwestlicher Richtung, kam die Flut knapp einen Monat früher als in Kalomo. Die Ursache war in Monze die gleiche wie in Kalomo: Dämme konnten den Regenfällen nicht mehr standhalten. Zahlreiche Menschen wurden obdachlos und hausen seither in winzigen Zelten in Lagern - sogenannten IDP-Camps (IDP steht für Internally Displaced People, Anm.) - als Binnenflüchtlinge um die Stadt Monze herum. "Die Flut kam am 6. Jänner. Um Mitternacht waren unsere Häuser unter Wasser", erzählt Malima Muyendekwa, Sprecher eines dieser Lager. "Am 7. Jänner in der Früh haben wir uns entschieden die Häuser zu verlassen." Muyendekwas Haus wurde von der Flut zerstört, ebenso die Ernte. Was mit seinem Vieh geschehen ist, weiß er nicht.
In diesem Camp sind Muyendekwa und seine Nachbarinnen und Nachbarn gelandet, weil sie den Besitzer des Landes gefragt haben, ob sie bleiben dürfen, erzählt der 54-Jährige. Schon bei einer früheren Flut haben sie sich hierhergerettet. Nun sind sie schon bald vier Monate in dem Lager. Die winzigen Zelte beherbergen oft mehr als ein Dutzend Menschen, Erwachsene und viele Kinder. In der prallen Sonne wird es unerträglich heiß.
Für Frauen und Mädchen ist die Situation im Camp am schlimmsten. Drei Kilometer ist es bis zur nächsten Stelle, wo einigermaßen sauberes Wasser zu bekommen ist. Das zu holen, ist in Sambia Frauenarbeit. Dazu kommen spezifische Gefahren. Es werde viel gestohlen. Und: "Es leben hier Menschen mit unterschiedlichem Background. Wenn sie Alkohol trinken, machen die Männer hier Probleme. Für uns ist es besonders gefährlich", sagt eine Lagerinsassin, ohne vor den männlichen Mitbewohnern spezifischer zu werden.
Zwei Wochen dauerte es, bis die Regierung die Zelte lieferte. Die erste Hilfe kam so einmal mehr von CARE. Lebensmittel wie Mais, Erdnüsse, Speiseöl, auch Sojabohnen und Süßwasser-Sardinen aus dem Tanganiyka-See waren in einem 25-Kilo-Paket, Utensilien zum Kochen, Decken, Schlafmatten und Ähnliches in einem zweiten. Dazu kam Geld, in einer ersten Tranche 400 Kwacha, etwas über 20 Euro.
Sambia hat kaum die Mittel, sich gegen die Folgen des Klimawandels zu wehren, geschweige denn, dagegen vorzusorgen. Die Flut hat in weiten Landstrichen die Ernte komplett vernichtet. Die Trockenzeit hat mit April begonnen, anbauen können die Menschen erst wieder im Spätherbst mit dem Anfang der nächsten Regenzeit. Wie sie über die nächsten Monate kommen sollen, ist offen. Da ist die Unterstützung von Hilfsorganisationen wie CARE dringend notwendig.
Die Sambier haben in den vergangenen Jahrzehnten große Gebiete abgeholzt, um aus den Bäumen Holzkohle zu machen. Diese wird gerade in ländlichen Regionen an allen Ecken und Enden benötigt, ist sie doch meist die einzige Möglichkeit, warme Speisen zuzubereiten. Aber damit haben sie auch selbst zum Klimawandel beigetragen.
Doch genau diese Bäume tragen auch zur größeren Widerstandsfähigkeit gegen den Klimawandel bei: So hat CARE mit lokalen Partnern im Bezirk Kalomo eine von mehreren sogenannten "Tree Nurserys" in Rahmen des Projekts BLRCC (Building Livelihood Resilience to Climate Change) aufgebaut. Mable Munsaka, Veniah Kafulo und ihre Mitstreiter haben dort eine Baumschule gegründet, die für Wiederaufforstungsprojekte in der Gegend Setzlinge liefert. Diese verkaufen sie in der Nachbarschaft und sichern so das Einkommen in ihrer Gemeinde. Dabei züchten sie einerseits das Robiniengewächs Gliricidia sepium, das Stickstoff im Boden bindet und so ohne chemische Düngemittel die Ernteerträge steigert. Außerdem ist es als Brennholz und zur Herstellung von Holzkohle geeignet. Andererseits wird die schnell wachsende Leucaena leucocephala hochgezogen, die tiefe Wurzeln bildet und so das Wasser speichert. Dass die Pflanzen ab einer gewissen Größe Schatten spenden, ist ein weiterer Vorteil in der heißen Gegend.
Gleich daneben präsentiert Kafulo den Gemüsegarten, in dem unter anderem der Kohl prächtig gedeiht. Auch Paradeiser, Raps, Karotten, Zwiebel und Afrikanische Melanzani (eine weiße Unterart) baut sie an. Verkauft wird das Gemüse in benachbarten Siedlungen. Das Konzept hinter dem Projekt ist Hilfe zur Selbsthilfe. Ein Beispiel: CARE und seine lokalen Partner haben den Dorfbewohnern gezeigt, wie sie Silagen anlegen können. Die solcherart konservierten Futtermittel, in Plastik verpackt und im Boden vergraben, helfen den Dorfbewohnern, ihr Vieh durch die Trockenzeit zu bringen.
Unterstützung bringt die Hilfsorganisation den Bauern auch im Bemühen, das Vieh widerstandsfähiger zu machen. Ebenfalls im Distrikt Kalomo etwa hilft CARE lokalen Partnern beim Wiederaufbau eines sogenannten Dip Tanks. Die Rinder müssen in ein mit einer Wasser- und Chemikalienlösung gefülltes sehr schmales Becken. Beim Durchqueren kann die Lösung gegen Zecken wirken, die Krankheiten übertragen.
Im Mittelpunkt der CARE-Projekte steht außerdem der Anbau von gegen die Dürre widerstandsfähigerer Sorten, etwa beim in Sambia besonders intensiv genutzten Mais. Statt dem im Land meist angebauten weißen Mais stellen die NGO-Mitarbeiter Samen für orangen Mais zur Verfügung. Der benötigt deutlich weniger Wasser, zeigte sich aber auch gegen die Flut deutlich härter.
"Trotz der Flut konnten wir ernten", schildert die Bäuerin Patricia. "Und das Nshima (sambisches Grundnahrungsmittel auf Maisbasis, Anm.) schmeckt auch mit dem orangen Mais sehr gut." Auch sie und ihre Familie wurden von der Flut schwer getroffen. "Der ganze Platz war überflutet." Im Haupthaus, wohin das Wasser nicht gelangte, harrten die 13 Familienmitglieder aus, bis die Flut ging. Immerhin, mit dem orangen Mais habe es trotz des Hochwassers eine Ernte gegeben.
Manchmal benötigt es aber einfach Nothilfe. Etwa für Fennie Mutibo, 85 Jahre alt, und ihre noch einmal drei Jahre ältere Schwester, denen die Flut in der Stadt Kalomo ihre Hütte zerstört hat. "Die Flut war das Schlimmste in meinem Leben, was ich erlebt habe", sagt Fennie Mutibo. Dass das Dach zusammengebrochen sei, war da nur eine Draufgabe. Und Mutibo hat einiges erlebt: 1953 gab es eine Hungerkrise. "Wir konnten nichts zu essen finden." Und auch 1985 kämpfte sie gegen den Hunger. Diesmal kam CARE: "Bestandsaufnahme, dann Nahrungsmittel, Kochutensilien und andere Güter. Und drittens Geld", umreißt ein Mitarbeiter der NGO das Vorgehen. "Ich kann gar nicht ausdrücken, wie dankbar ich bin", sagt Mutibo. Und lächelt.
Zusammenfassung
- Der Klimawandel trifft Entwicklungsländer besonders.
- Davon kann Sambia, Binnenstaat im südlichen Afrika, ein Lied singen.
- In der vergangenen Regenzeit trafen nach monatelanger Dürre schwere Regenfälle das ausgedörrte Land.
- In Kalomo, einem Distrikt in der Südprovinz Sambias, rund 400 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Lusaka, kam die Flut am 2. Februar.
- Doch, wie Siasaniyama und Chilenga schildern, hat das Wasser dem Boden nichts gebracht.